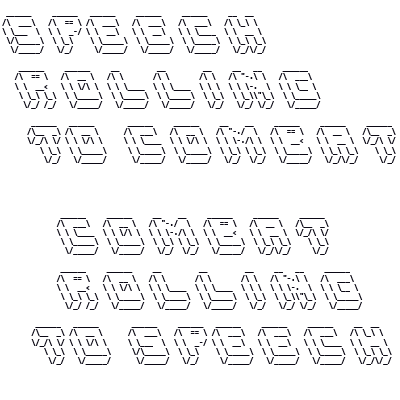“Man sollte mal wieder mehr ins Theater” und ähnliche klassische Kulturprobleme akademischer Mittelschichten betreffen immer weniger Menschen. Zu behaupten, immer mehr Menschen trieben sich stattdessen auf Facebook herum, um dort bequem Chemtrails, Verschwörungstheorien und Antisemitismusproblemen nachgehen zu können, wäre vermutlich brutal kulturpessimistisch, ist vielleicht aber wahr. Noch vor einigen Jahren haben wir (Bildungsbürger) mitleidig auf jene Milieus (der Fortschrittsverlierer) geblickt, denen wir unterstellten nicht außreichend Zugang zu kulturellem Kapital zu haben (und damit meinten wir plusminus das Wiener Burgtheater). Mittlerweile bekommen wir es mit der Angst zu tun. Verschwörungstheorien und Antisemitismusprobleme werden in Österreich immerhin schon von der umfragenstärksten Partei repräsentiert (in Deutschland steht die AfD bei 10-15% und es ist immerhin Deutschland).
So überzeugend also beispielsweise die Sitzauslastung bei Aufführungen von Schuberts Winterreise noch immer sein mag und selbst wenn das nächste Screening von Fritz Langs Metropolis wieder das Zeug zum Event haben wird, verglichen mit dem HC-Strache-Rap und den Videos des IS ist all das in der Breitenwirkung irrelevant. Die Antworten unseres kulturellen Erbes, beispielsweise auf Fragen der Entfremdung durch Technisierung und Industrialisierung sind historische Antworten auf historische Probleme. Sie lösen keine Probleme der Gegenwart.
„Wir erleben nicht mehr das Drama der Entfremdung, wir erleben den Extase der Kommunikation“, schrieb Jean Baudrillard 1987 in seiner Habilitation „Das Andere selbst“. Selbst wenn wir also in Zukunft viel mehr Kinder in Bundesmuseen und -theater bringen, werden wird damit weder religiösen, noch rechten Extremismus eindämmen können. Dafür bräuchten wir eine andere Perspektive auf Kulturpolitik.
„Rechtspopulismus und IS haben aber nichts mit Kunst- und Kulturpolitik zu tun, denn Kunst muss schließlich zweckfrei sein“ – mag sich jetzt der freiheitsliebende akademische Mittelbau an der Kunstakademie denken? Falsch! Aus Steuergeldern geförderte Kunst- und Kulturproduktion hat genau so viel oder wenig im Dienst des Lebens unter dem Verfassungsbogen zu stehen, wie alle anderen öffentlich finanzierten gesellschaftlichen Sphären auch.
Der ehemalige Rektor der Akademie für Angewandte Kunst, Rudolf Burger, kritisierte 1996 in seiner Antrittsrede, dass Kunst die Kultur nicht mehr transzendiere. Als Kulturkunst sei die normativ höchste Ebene kultureller Aushandlung in die Banalität der selbsterhaltenden Kontrollgesellschaft hinein gezogen worden. Kultur diene nur noch als Distinktionswerkzeug der „Bürgerlichen“ gegen den drohenden sozialen Abstieg zum „Prolo“, sie sei also höchstens noch systemstabilisierend. Den „Prolo“ wiederum überlasse die Politik den rechten Demagogen. Kulturkunst handle Kritik in einer affirmativen Weise ab die den den Mächtigen nicht weh tue.
Einerseits nimmt Kulturkunst der Kunst das kritische Potential. Sie produziert heute statt relevanter Kritik nur noch anti-Atom-anti-Kohle-anti-Windrad-in-meiner-Öko-Community-Wutbürger, deren kritisches Potential sich im TTIP-blöd-finden erschöpft. Das andere Ende der Skala ist aber viel problematischer: Die Abgrenzung zum vermeintlichen “Fortschrittsverlierer”. „Die Versöhnung von Kunst und Kultur ist die Ideologie einer Gesellschaft, die sich selbst in ihrem Eigentums- und Machtverhältnissen kein Thema mehr ist und die deshalb die Defizite der Sozialpolitik der Kulturpolitik zur symbolischen Verarbeitung überlässt; die ist dabei natürlich strukturell überfordert,“ so Burger.
Während sich Europa vor der Jahrtausendwende auf den Höhepunkt des (sozialdemokratischen) Neoliberalismus unter Blair und Schröder zu bewegte und sich daher vor allem mit diesem ersten Aspekt der „Kritikfähigkeit von Kunst- und Kultur“ beschäftigte, war in Österreich, mit dem Aufstieg Haiders, schon eine zweite Entwicklung klar abzusehen: Die Kulturkunst hat die „Fortschrittsverlierer“ immer schlechter integrieren können.
So war beispielsweise das auffälligste in Erscheinung treten der Akademie der Bildenden Künste Wien im letzten Jahrzehnt „Uni Brennt“, also die Solidarisierung mit allen möglichen lateinamerikanischen Arbeiterinnen und allerhand basisdemokratische Institutionenkritik innerhalb einer Institution in der beispielsweise der Young-Angry-White-Male aus Wien Favoriten dann doch unhinterfragt klar unterrepräsentiert blieb. Im Nachhinein ist man immer schlauer aber das war, im Rückblick, vielleicht zu wenig. Was sich seit Rudolf Burger 1996 also geändert hat? Kulturkunst wirkt nichtmal mehr in relevantem Ausmaß systemstabilisierend.
Spätestens seit die Digitalisierung und Vernetzung unserer Kommunikation hat die Kulturkunst das Spielfeld dem Netz überlassen. Während Maria Fekter und Josef Cap noch im vergangenen parlamentarischen Kulturausschuss im Oktober 2015 debattierten, was das Dollfuss-Bild im ÖVP-Klub für das Haus der Geschichte bedeutet, rappte HC Strache für 289.000 Facebook-Fans. Andreas Gabalier besaß damalsch schon eine Reichweite von 565.000 Menschen, Moneyboy 285.000, Florian Meindl 165.000, das MUMOK 36.000 und das Burgtheater 15.000. Andreas Gabalier beschränkt sich mit dieser Reichweite nicht auf Schunkellieder und Florian Meindl taucht in der Wahrnehmung „österreichischer Kulturproduktion“ nichtmal auf.
Daher läuft mittlerweile selbst das Argument, Religion und Blasmusikvereine seien immer viel breitenwirksamer gewesen als Hochkultur, ins Leere. HC-Strache, Gabalier, Chemtrail-Pegida-Verschwörungsgruppen auf Facebook und IS-Videos sind die neuen Blasmusikvereine. Sie bewegen sich nur leider außerhalb des von uns demokratisch gewünschten Rahmens. Diese neuen Angebote im digitalisierten, virtualisierten und vernetzten Raum bieten relevante Sinnangebote im Umgang mit den Herausforderungen des Lebens in der Gegenwart.
Jede Zeit und alle Machtverhältnisse lösen gesellschaftliche Probleme der Vergangenheit und schaffen neue. Die Machtverhältnisse der Gegenwart werden oft mit dem Begriff Neoliberalismus beschrieben. Der Berliner Philosoph(iestar) Byung-Chul Han meint, der Neoliberalismus sei ein „sehr effizientes, ja intelligentes System, die Freiheit selbst auszubeuten”. Die Freiheit wird nicht mehr wie noch in der Disziplinargesellschaft durch staatliche Mächte eingeschränkt, sondern durch Selbstoptimierung ausgebeutet. Nicht mehr Geworfenheit in eine bestimmte hierarchiche Position in der Gesellschaft, sondern das Gefühl der Gewordenheit des ständigen werden müssens ist dominant. Aus der Möglichkeiten alles werden zu können, entsteht der Zwang auch alles werden zu müssen. Als unternehmerische Einzeln der Generation Berlin, wie es der Soziologe Heinz Bude beschrieb, leben wir mit der Last der ständigen Selbstvermarktung. Diese Entwicklung ging Hand in Hand mit den Selbstverwirklichungs- und Kreativitätszwängen der Globalisierung, Digitalisierung und Vernetzung.
[Darum hat auch die linke Theorie um Armen Avanessian mit dem “Akzelerationismus” unrecht. Neoliberalismus ist nicht irgendwelches Kapital in irgendwelchen falschen Händen, sondern die Beschleunigung, Digitalisierung, Virtualisierung und Dezentralisierung von Macht selbst. Eine Linke, die versucht durch Beschleunigung wettbewerbsfähig mit dem stets schnelleren und druckvolleren Kapitalismus zu werden, um diesen zu überwinden ist (wenn man die Begriffe unbedingt verwenden will) selbst neoliberal und verstärkt genau jene Charakterstika und Machtverhältnisse des Neoliberalismus, welche die Menschen als negativ und unangenehm empfinden. Sich selbst als „links“ zu identifizieren immunisiert dagegen nicht.]
Byung-Chul Han beschreibt diese Entwicklung hin zur Hyperkulturalität 2005 folgendermaßen: Kultur bestehe heute aus Links und Vernetzungen. Trans-, Inter-, und Multi- seien keine sinnvollen Präfixe mehr, weil Kultur kein örtlich abgrenzbarer Kanon mehr sei.
IS-Videos, Chemtrail-Pages, aber auch Kunstblasen auf Tumblr entstehen im Hyperraum. Eine Kulturpolitik der Re-Nationalisierung, Re-Institutionalisierung und Re-Lokalisierung kann nicht mithalten. In jeder Legislaturperiode einfach neue repräsentative Kulturkunst-Biotope zu schaffen, geht an der Entwicklung dieser kulturellen Aushandlungsprozesse vorbei. Wenn Kulturpolitik, als demokratisch legitimierte Größe, an kultureller Aushandlung teilnehmen möchte, dann muss sie Hyperkulturpolitik sein. Wenn Relevanz und Wirksamkeit zählen sollen, dann muss von den rund 450 Millionen Euro jährlicher Kulturförderung des Bundes, ein angemessen großer Anteil, in diesem Gegenwartsdiskurs konkurrenzfähige Angebote schaffen – in der Spitze und in der Breite.
Liberale Kulturpolitik hat den Vorteil, dass sie den Neoliberalismus, die Beschleunigung und Konvergenz nicht “böse” finden muss, sondern als gegeben akzeptiert kann. Das ermöglicht ihr den Blick auf das richten, was nötig ist um in der Gegenwart zu leben – ausgehend vom Individuum und für möglichst viele Menschen. Was kann das konkret heißen? Kunstförderung muss Unruhe produzieren. Kunst, die ihre Jugend nicht gefährdet, geht nicht weit genug. Kultur muss hingegen genug integrative Kraft und Breite haben um den Menschen attraktive Sinnangebote innerhalb des demokratischen Spektrums zu machen. Gleichzeitig wird Kulturpolitik als Sozialpolitik nicht nur scheitern, sie ist es bereits. Das klingt ein bisschen widersprüchlich, wäre im Grunde aber ein brauchbarer handlungsleitender Maßstab (wenn man an konkrete Entscheidungen wie ein Haus der Geschichte am Heldenplatz (sic!), 15 Mio. Euro mehr für die Bundestheater, oder irgendeinen neuen Literaturpreis denkt). Denn die Unterhaltung von uns Kulturkunstkonsumenten, oder die Frage ob Künstler angenehm von ihrer Produktion leben können, sind derzeit die am wenigsten wichtigen Fragen der Kulturpolitik.
Das ist jetzt aber alles gar nicht so hoffnungslos, wie es klingt, denn zum Glück gibt es ja Niko Alm:
Der stellt
die richtigen Fragen
in den richtigen Schriftarten.